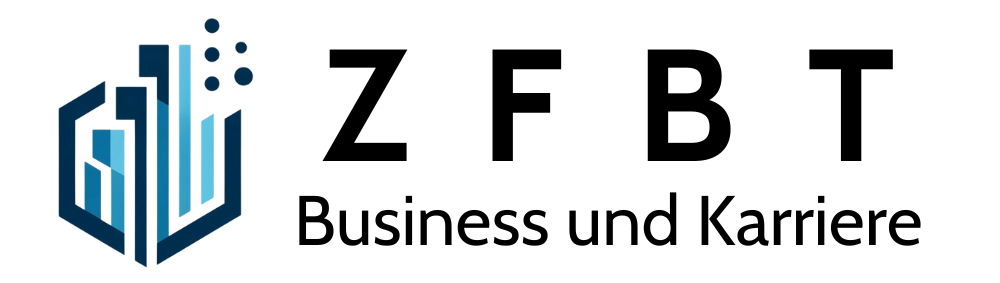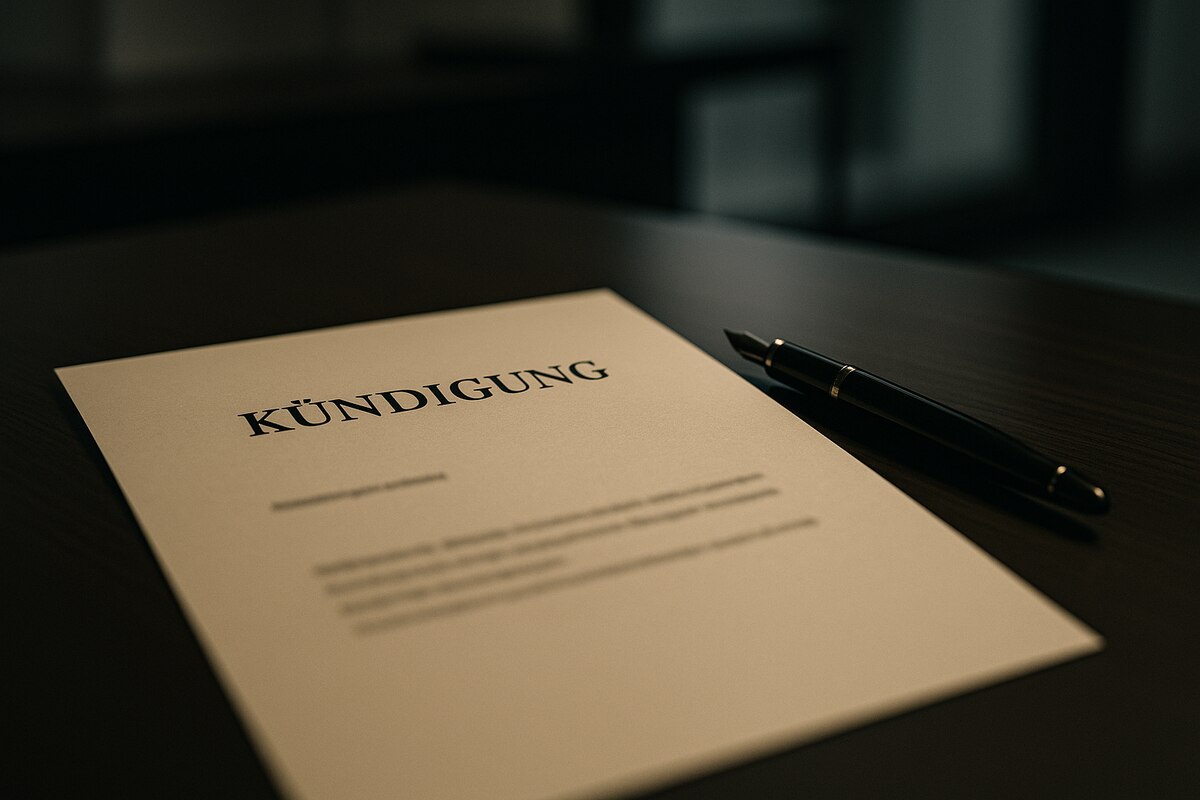Die Entscheidung, einem Mitarbeiter zu kündigen, gehört zu den schwierigsten und unangenehmsten Aufgaben im unternehmerischen Alltag. Sie ist mit rechtlichen Hürden, emotionalen Belastungen und einer großen Verantwortung verbunden. Viele Führungskräfte und Personalverantwortliche stehen vor der drängenden Frage, wo sie eine verlässliche Vorlage für die Kündigung durch den Arbeitgeber finden und welche Fallstricke es unbedingt zu vermeiden gilt.
Dieser Artikel ist mehr als nur eine Sammlung von Paragrafen. Er ist Ihr persönlicher Mentor, der Sie sicher durch diesen komplexen Prozess führt. Wir nehmen Ihre Unsicherheit ernst und verwandeln sie Schritt für Schritt in Handlungskompetenz. Am Ende dieser Lektüre werden Sie nicht nur wissen, wie ein Kündigungsschreiben formal korrekt aussieht, sondern auch, wie Sie den gesamten Vorgang fair und menschlich gestalten können.
- Schriftform ist zwingend: Eine Kündigung muss immer schriftlich erfolgen und handschriftlich vom Arbeitgeber oder einem Bevollmächtigten unterzeichnet sein (§ 623 BGB). Eine E-Mail oder mündliche Aussage ist unwirksam.
- Eindeutige Formulierung: Das Schreiben muss klar und unmissverständlich als Kündigung erkennbar sein und den genauen Beendigungszeitpunkt des Arbeitsverhältnisses nennen.
- Fristen beachten: Die gesetzlichen, vertraglichen oder tariflichen Kündigungsfristen müssen exakt eingehalten werden, um die Kündigung nicht anfechtbar zu machen.
- Zugang nachweisen: Der Arbeitgeber muss beweisen können, dass der Arbeitnehmer die Kündigung erhalten hat. Eine persönliche Übergabe mit Empfangsbestätigung ist der sicherste Weg.
- Hinweispflichten erfüllen: Weisen Sie den Arbeitnehmer auf seine Pflicht hin, sich umgehend bei der Agentur für Arbeit zu melden, um Nachteile beim Arbeitslosengeld zu vermeiden.
Das Fundament: Die gesetzlichen Rahmenbedingungen einer Kündigung
Bevor wir uns der eigentlichen Vorlage widmen, müssen wir das Fundament legen. Eine Kündigung schwebt nicht im luftleeren Raum; sie ist fest in das deutsche Arbeitsrecht eingebettet. Wer diese Grundlagen ignoriert, riskiert, dass die Kündigung vor dem Arbeitsgericht scheitert – mit teuren Folgen.
Verstehen Sie die folgenden Punkte daher nicht als trockene Theorie, sondern als das entscheidende Rüstzeug für Ihr Handeln.
Die Schriftform: Das unumstößliche Gebot
Die wichtigste Regel zuerst: Eine Kündigung muss immer schriftlich erfolgen. Das besagt § 623 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) unmissverständlich. „Schriftlich“ bedeutet auf Papier, mit einer originalen, handschriftlichen Unterschrift des Arbeitgebers oder einer vertretungsberechtigten Person (z.B. Geschäftsführer, Prokurist).
Was bedeutet das im Umkehrschluss?
Eine Kündigung per E-Mail, Fax, SMS oder gar mündlich im Gespräch ist rechtlich unwirksam. Sie entfaltet keinerlei Wirkung, das Arbeitsverhältnis besteht unverändert fort. Machen Sie hier keine Experimente, der Formfehler ist einer der häufigsten und zugleich einfachsten Gründe für eine erfolgreiche Kündigungsschutzklage.
Die Kündigungsfristen: Ein präzises Timing ist alles
Die zweite Säule ist die Einhaltung der korrekten Kündigungsfrist. Diese bestimmt, zu welchem Datum das Arbeitsverhältnis tatsächlich endet. Die Fristen können sich aus dem Arbeitsvertrag, einem anwendbaren Tarifvertrag oder dem Gesetz ergeben.
Gibt es keine spezielleren Regelungen, greifen die gesetzlichen Fristen aus § 622 BGB. Diese verlängern sich, je länger der Arbeitnehmer im Betrieb beschäftigt war. Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen klaren Überblick über die gesetzlichen Fristen für den Arbeitgeber.
| Dauer der Betriebszugehörigkeit | Kündigungsfrist |
|---|---|
| Probezeit (max. 6 Monate) | 2 Wochen zu jedem beliebigen Tag |
| nach der Probezeit bis 2 Jahre | 4 Wochen zum 15. oder zum Ende eines Kalendermonats |
| ab 2 Jahren | 1 Monat zum Ende eines Kalendermonats |
| ab 5 Jahren | 2 Monate zum Ende eines Kalendermonats |
| ab 8 Jahren | 3 Monate zum Ende eines Kalendermonats |
| ab 10 Jahren | 4 Monate zum Ende eines Kalendermonats |
| ab 12 Jahren | 5 Monate zum Ende eines Kalendermonats |
| ab 15 Jahren | 6 Monate zum Ende eines Kalendermonats |
| ab 20 Jahren | 7 Monate zum Ende eines Kalendermonats |
Achten Sie penibel auf die Formulierung „zum Ende eines Kalendermonats“. Eine Kündigung, die zum 30. April ausgesprochen wird, muss dem Mitarbeiter bei einer einmonatigen Frist spätestens am 31. März zugegangen sein.
Für Arbeitnehmer gilt in der Regel die Grundkündigungsfrist von vier Wochen zum 15. oder zum Monatsende, es sei denn, der Arbeitsvertrag sieht eine längere Frist vor. Vertraglich darf für den Arbeitnehmer jedoch niemals eine längere Frist als für den Arbeitgeber festgelegt werden.
Der Kündigungsschutz: Nicht jeder ist sofort kündbar
In Betrieben mit in der Regel mehr als zehn Mitarbeitern (Auszubildende zählen nicht mit) und bei Arbeitnehmern, die länger als sechs Monate beschäftigt sind, greift das Kündigungsschutzgesetz (KSchG). In diesem Fall benötigen Sie für eine ordentliche Kündigung einen sozial gerechtfertigten Grund.
Diese Gründe können personenbedingt (z.B. langanhaltende Krankheit), verhaltensbedingt (z.B. wiederholte Pflichtverletzungen nach Abmahnung) oder betriebsbedingt (z.B. Wegfall des Arbeitsplatzes durch Umstrukturierung) sein. Eine Kündigung ohne einen solchen Grund ist in diesen Betrieben unwirksam.
Die Anatomie eines rechtssicheren Kündigungsschreibens: Schritt für Schritt erklärt
Jetzt, wo das Fundament steht, können wir das Haus bauen. Ein Kündigungsschreiben folgt einer klaren Struktur. Jedes Element hat seine Funktion und trägt zur Rechtssicherheit bei. Betrachten Sie die folgende Anleitung als Blaupause für Ihr individuelles Schreiben.
Der Briefkopf: Klare Verhältnisse schaffen
Ganz oben stehen die vollständigen und korrekten Adressdaten beider Parteien. Links oben Ihre als Arbeitgeber, rechtsbündig darunter die des Arbeitnehmers. Fehler bei Namen oder Anschrift können zwar heilbar sein, wirken aber unprofessionell und sollten vermieden werden.
Datum und Betreff: Unmissverständlich und direkt
Rechtsbündig, oberhalb des Betreffs, platzieren Sie das aktuelle Datum – also den Tag, an dem Sie das Schreiben aufsetzen und unterzeichnen. Der Betreff sollte keine Fragen offenlassen. Formulierungen wie „Kündigung Ihres Arbeitsverhältnisses vom [Datum des Arbeitsvertrags]“ oder schlicht „Kündigung“ sind ideal.
Vermeiden Sie vage Betreffzeilen wie „Wichtige Mitteilung“ oder „Unser Gespräch vom…“.
Die Anrede und die Kündigungserklärung: Das Herzstück
Beginnen Sie mit einer förmlichen Anrede: „Sehr geehrte/r Herr/Frau [Nachname],“. Kommen Sie danach direkt zum Punkt. Die Kündigungserklärung muss absolut eindeutig sein. Es darf kein Zweifel daran bestehen, dass Sie das Arbeitsverhältnis beenden wollen.
Eine bewährte Formulierung lautet:
„hiermit kündigen wir das zwischen Ihnen und uns am [Datum des Vertragsabschlusses] geschlossene Arbeitsverhältnis ordentlich und fristgerecht zum [Beendigungsdatum].“
Dieser eine Satz enthält alles Notwendige: die klare Kündigungsabsicht, die Bezugnahme auf den Vertrag, die Art der Kündigung (ordentlich) und das exakte Enddatum.
Um sich gegen eine falsch berechnete Kündigungsfrist abzusichern, fügen viele Arbeitgeber eine Hilfsklausel hinzu: „…hilfsweise zum nächst zulässigen Zeitpunkt.“ Sollte sich die von Ihnen berechnete Frist als zu kurz erweisen, greift automatisch die korrekte, längere Frist und die Kündigung bleibt wirksam.
Optionale, aber sinnvolle Ergänzungen
Ein Kündigungsschreiben kann mehr als nur das Nötigste enthalten. Zusätzliche Informationen schaffen Klarheit, beugen Missverständnissen vor und zeugen von einem fairen Umgang. Überlegen Sie, welche der folgenden Punkte für Ihre Situation relevant sind:
- Dank und Zukunftswünsche: Eine kurze, höfliche Dankesformel für die geleistete Arbeit und gute Wünsche für die Zukunft sind ein Zeichen von Respekt und können zur Deeskalation beitragen.
- Angebot der Freistellung: Sie können den Mitarbeiter ab sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt unter Fortzahlung der Bezüge von der Arbeit freistellen. Dies sollte mit dem Hinweis verbunden werden, dass Resturlaub damit als gewährt gilt.
- Regelung des Resturlaubs: Alternativ zur Freistellung können Sie angeben, wie viele Tage Resturlaub noch bestehen und wann diese genommen werden sollen.
- Hinweis auf das Arbeitszeugnis: Bieten Sie proaktiv die Erstellung eines „qualifizierten Arbeitszeugnisses“ an. Dies nimmt dem Mitarbeiter eine Sorge und zeigt Ihr Entgegenkommen.
- Aufforderung zur Rückgabe von Firmeneigentum: Listen Sie auf, welche Gegenstände (Laptop, Handy, Schlüssel, Firmenwagen etc.) bis wann zurückzugeben sind.
- Anhörung des Betriebsrats: Falls ein Betriebsrat existiert, ist eine korrekte Anhörung des Betriebsrats vor der Kündigung zwingend erforderlich. Ein entsprechender Hinweis im Schreiben kann sinnvoll sein.
Die Pflichten nach der Kündigung: Was jetzt noch wichtig ist
Mit der Unterschrift ist der Prozess noch nicht abgeschlossen. Insbesondere eine gesetzliche Pflicht müssen Sie als Arbeitgeber unbedingt erfüllen, um den Mitarbeiter nicht zu schädigen und sich selbst nicht angreifbar zu machen.
Der Hinweis auf die Meldepflicht bei der Agentur für Arbeit
Gemäß § 38 Abs. 1 SGB III sind Sie verpflichtet, den Arbeitnehmer auf seine Meldepflicht bei der Agentur für Arbeit hinzuweisen. Er muss sich zur Aufrechterhaltung ungekürzter Ansprüche auf Arbeitslosengeld unverzüglich nach Erhalt der Kündigung persönlich arbeitssuchend melden. Fehlt dieser Hinweis, können Sie unter Umständen schadensersatzpflichtig werden, falls dem Mitarbeiter dadurch finanzielle Nachteile entstehen.
Integrieren Sie daher immer einen entsprechenden Passus in Ihr Schreiben.
Fazit: Klarheit, Sorgfalt und Fairness
Eine Kündigung auszusprechen, wird niemals einfach sein. Doch mit dem richtigen Wissen und einer sorgfältigen Vorbereitung können Sie den Prozess rechtssicher und fair gestalten. Eine gute Vorlage ist dabei ein wertvolles Werkzeug, aber sie ersetzt niemals das Verständnis für die rechtlichen und menschlichen Hintergründe. Gehen Sie den Prozess mit Klarheit, Präzision und dem nötigen Respekt vor dem Mitarbeiter an. So schützen Sie nicht nur Ihr Unternehmen vor rechtlichen Risiken, sondern wahren auch eine professionelle und anständige Unternehmenskultur, selbst in schwierigen Momenten.
Häufig gestellte Fragen
Muss ich in einer ordentlichen Kündigung einen Grund angeben?
Nein, im Geltungsbereich des Kündigungsschutzgesetzes müssen Sie zwar einen Grund haben, diesen aber nicht zwingend im Kündigungsschreiben selbst nennen. Außerhalb des KSchG (z.B. in Kleinbetrieben) ist eine ordentliche Kündigung auch ohne Grund möglich.
Was passiert, wenn ich die Kündigungsfrist falsch berechne?
Eine zu kurz berechnete Frist führt nicht zur Unwirksamkeit der gesamten Kündigung, wenn sie so ausgelegt werden kann, dass sie zum nächst korrekten Termin gelten soll. Die Verwendung der „hilfsweisen“ Kündigungsklausel ist hierfür die beste Absicherung.
Wie übergebe ich die Kündigung rechtssicher?
Der sicherste Weg ist die persönliche Übergabe unter Zeugen, wobei sich der Mitarbeiter den Erhalt auf einer Kopie des Schreibens mit Datum und Unterschrift bestätigt. Weigert er sich, kann der Zeuge den Vorgang bezeugen. Alternativ ist die Zustellung durch einen Boten möglich, der den Einwurf in den Briefkasten protokolliert.
Kann eine Kündigung per E-Mail oder WhatsApp erfolgen?
Nein, absolut nicht. Das Gesetz schreibt zwingend die Schriftform mit Originalunterschrift vor (§ 623 BGB). Jede Kündigung in elektronischer Form ist von vornherein unwirksam und hat keine rechtliche Wirkung.