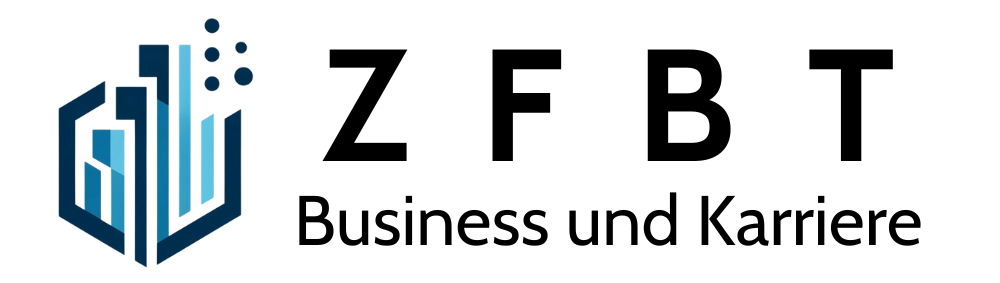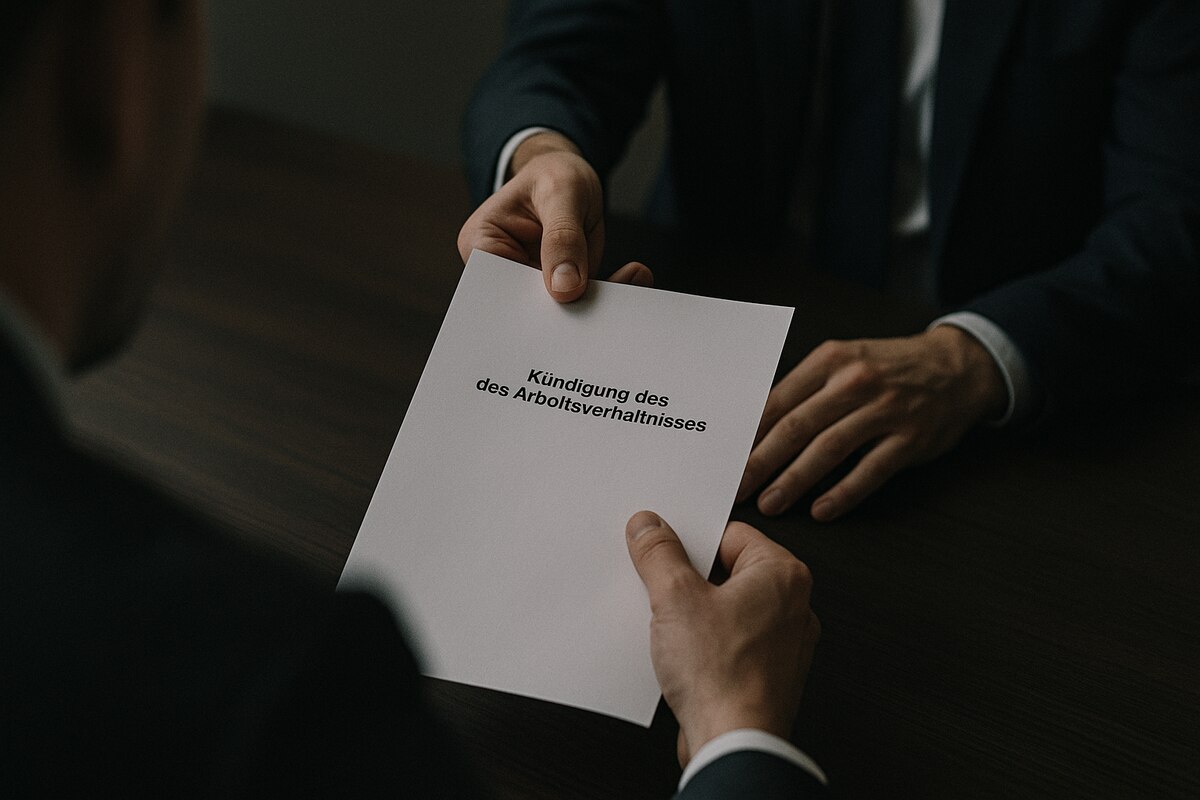Der Brief liegt auf dem Tisch, das Gespräch mit dem Vorgesetzten hallt nach. Eine Kündigung. Doch nicht irgendeine – eine verhaltensbedingte Kündigung. Dieser Begriff wiegt schwer, denn er impliziert einen Vorwurf, ein persönliches Fehlverhalten. Die Unsicherheit ist oft groß und viele Arbeitnehmer fragen sich, welche konkreten Beispiele zu einer verhaltensbedingten Kündigung führen können und ob das Vorgehen des Arbeitgebers überhaupt rechtens ist.
Dieser Artikel ist Ihre Reise von dieser Ungewissheit hin zu fundiertem Wissen und klarer Handlungskompetenz. Wir beleuchten die rechtlichen Grundlagen, die entscheidende Rolle der Abmahnung und zeigen Ihnen anhand praxisnaher Beispiele, wann ein Verhalten tatsächlich eine Kündigung rechtfertigen kann – und wann nicht.
- Eine verhaltensbedingte Kündigung setzt ein steuerbares, willentliches Fehlverhalten des Arbeitnehmers voraus, das einen Vertragsverstoß darstellt.
- In den allermeisten Fällen muss der Kündigung eine einschlägige, erfolglose Abmahnung vorausgehen. Sie ist der obligatorische „Warnschuss“.
- Die Gründe lassen sich in drei Bereiche einteilen: Störungen im Leistungsbereich, im Vertrauensbereich und in der betrieblichen Ordnung.
- Vor jeder Kündigung muss eine umfassende Interessenabwägung stattfinden, bei der die Interessen beider Parteien gegeneinander abgewogen werden.
- Der Arbeitgeber trägt die volle Beweislast für das vorgeworfene Fehlverhalten und die Einhaltung aller formellen Schritte.
Die verhaltensbedingte Kündigung: Mehr als nur ein Vorwurf
Haben Sie sich je gefragt, was eine verhaltensbedingte Kündigung von anderen Kündigungsarten unterscheidet? Der entscheidende Punkt liegt im Wort „Verhalten“. Anders als bei einer betriebsbedingten Kündigung (z.B. wegen Auftragsmangels) oder einer personenbedingten Kündigung (z.B. wegen langanhaltender Krankheit) liegt die Ursache hier in einem willentlich steuerbaren Handeln des Arbeitnehmers. Es geht also nicht um äußere Umstände oder um fehlende Fähigkeiten, sondern um einen Verstoß gegen die Spielregeln des Arbeitsvertrags.
Der Gesetzgeber hat hierfür hohe rechtliche Hürden aufgebaut. Eine Kündigung ist immer das letzte Mittel, die „ultima ratio“.
Die drei Säulen der Wirksamkeit: Die rechtlichen Hürden
Damit eine verhaltensbedingte Kündigung vor einem Arbeitsgericht Bestand hat, müssen mehrere Voraussetzungen wie Zahnräder ineinandergreifen. Fehlt auch nur ein Teil, ist die Kündigung in der Regel unwirksam.
Zuerst muss eine objektive Pflichtverletzung vorliegen. Der Arbeitnehmer muss gegen eine Haupt- oder Nebenpflicht aus seinem Arbeitsvertrag verstoßen haben. Das kann die Pflicht zur Arbeit selbst sein, aber auch die Pflicht zur Loyalität oder zur Wahrung des Betriebsfriedens.
Zweitens muss das Verhalten rechtswidrig und schuldhaft sein. Das bedeutet, der Arbeitnehmer handelte vorsätzlich oder zumindest fahrlässig. Ein Versehen, das jedem einmal passieren kann, reicht in der Regel nicht aus.
Drittens muss eine negative Zukunftsprognose bestehen. Der Arbeitgeber muss davon ausgehen können, dass der Arbeitnehmer sein vertragswidriges Verhalten auch in Zukunft nicht ändern wird. Genau hier kommt die Abmahnung ins Spiel, die beweisen soll, dass selbst eine Warnung nicht gefruchtet hat.
Zuletzt erfolgt die Interessenabwägung. Hier wird das Interesse des Arbeitgebers an der Beendigung des Arbeitsverhältnisses gegen das Interesse des Arbeitnehmers am Erhalt seines Arbeitsplatzes abgewogen. Faktoren wie Betriebszugehörigkeit, Alter, Unterhaltspflichten und die Schwere des Verstoßes spielen hier eine entscheidende Rolle.
Die Abmahnung: Der Warnschuss vor dem Urteil
Die Abmahnung im Arbeitsrecht ist das wohl wichtigste Instrument im Vorfeld einer verhaltensbedingten Kündigung. Sie ist weit mehr als eine bloße Ermahnung. Sie ist ein formalisierter rechtlicher Schritt mit drei zentralen Funktionen: Dokumentation, Rüge und Warnung.
Sie dokumentiert das exakte Fehlverhalten (was, wann, wo?), rügt dieses als Vertragsverstoß und warnt unmissverständlich davor, dass im Wiederholungsfall die Kündigung droht. Ohne diese Warnfunktion ist eine Abmahnung oft wertlos und berechtigt später nicht zur Kündigung.
Der Grundsatz lautet: Keine verhaltensbedingte Kündigung ohne vorherige Abmahnung.
Wann ist eine Abmahnung entbehrlich?
Doch es gibt Ausnahmen. In manchen Fällen ist das Fehlverhalten so gravierend, dass dem Arbeitgeber eine weitere Zusammenarbeit schlicht nicht mehr zugemutet werden kann. Das Vertrauensverhältnis ist dann nachhaltig zerstört. Man spricht hier vom sogenannten Vertrauensbereich.
Dies gilt vor allem bei Straftaten wie Diebstahl, Betrug oder Tätlichkeiten gegenüber Kollegen oder Vorgesetzten. In solchen Fällen kann der Arbeitgeber auch ohne vorherige Abmahnung eine ordentliche, oft sogar eine fristlose Kündigung aussprechen. Ebenso kann eine Abmahnung entfallen, wenn von vornherein klar ist, dass sie zu keiner Verhaltensänderung führen wird, etwa weil der Arbeitnehmer sein Fehlverhalten hartnäckig leugnet oder sogar ankündigt, es zu wiederholen.
Der berühmte Fall „Emmely“ zeigte, dass selbst bei einem Diebstahl (hier zwei Pfandbons im Wert von 1,30 Euro) eine Kündigung nach 31 Jahren Betriebszugehörigkeit unverhältnismäßig sein kann. Dies unterstreicht die enorme Bedeutung der individuellen Interessenabwägung.
Aus der Theorie in die Praxis: Konkrete Beispiele für eine verhaltensbedingte Kündigung
Nun wird es konkret. Die denkbaren Gründe sind vielfältig und lassen sich am besten in drei Kategorien einteilen. Diese Struktur hilft dabei, die Art des Verstoßes besser einzuordnen.
Verstöße im Leistungsbereich: Wenn die Arbeit leidet
Hier geht es um die Kernpflicht eines jeden Arbeitnehmers: die Erbringung der vereinbarten Arbeitsleistung. Ein wiederholter Verstoß kann nach Abmahnung zur Kündigung führen.
- Arbeitsverweigerung: Ein Mitarbeiter weigert sich beharrlich, ihm zugewiesene, zumutbare Aufgaben zu erledigen.
- Schlechtleistung: Ein „Low Performer“ zu sein, ist an sich kein Kündigungsgrund. Kündigungsrelevant wird es erst, wenn der Mitarbeiter absichtlich und dauerhaft deutlich unter seinen persönlichen Fähigkeiten arbeitet und seine Leistung auch nach einer Abmahnung nicht steigert.
- Ständige Unpünktlichkeit: Wer wiederholt und trotz Abmahnung zu spät zur Arbeit kommt, riskiert eine Kündigung. Minuten können hier entscheidend sein.
- Unentschuldigtes Fehlen: Das eigenmächtige Fernbleiben von der Arbeit ohne Angabe von Gründen ist ein klarer Vertragsbruch.
Erschütterung des Vertrauens: Die schwersten Vergehen
Diese Kategorie umfasst die gravierendsten Verstöße, da sie die Basis jeder Zusammenarbeit zerstören: das gegenseitige Vertrauen. Hier ist eine Abmahnung oft entbehrlich.
Ein klassisches Beispiel ist der Diebstahl oder die Unterschlagung von Firmeneigentum. Dabei spielt der Wert des gestohlenen Gegenstands oft eine untergeordnete Rolle; es geht um den Vertrauensbruch an sich. Auch der Arbeitszeitbetrug, etwa durch manipulierte Stempelzeiten von Kollegen, fällt in diese Kategorie und rechtfertigt meist eine fristlose Kündigung. Ebenso wie der Spesenbetrug, bei dem Reisekosten falsch oder überhöht abgerechnet werden. Die Weitergabe von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen an Dritte ist ein weiterer schwerwiegender Vertrauensbruch.
Störung des Betriebsfriedens: Wenn das Miteinander unmöglich wird
Ein Arbeitsverhältnis besteht nicht nur aus Leistung und Vertrauen, sondern auch aus einem funktionierenden Miteinander. Stört ein Mitarbeiter den Frieden im Betrieb nachhaltig, kann auch das ein Kündigungsgrund sein.
Dazu zählen grobe Beleidigungen von Kollegen oder Vorgesetzten, rassistische Äußerungen oder Mobbing. Auch sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist ein absolutes No-Go und führt oft zur sofortigen Kündigung. Ein weiteres heikles Thema ist Alkohol am Arbeitsplatz. Verstößt ein Mitarbeiter gegen ein klares Alkoholverbot, kann dies nach einer Abmahnung eine Kündigung nach sich ziehen. Vorsicht ist jedoch bei einer diagnostizierten Alkoholsucht geboten – hier könnte es sich um eine Krankheit handeln, was eine personenbedingte Kündigung nahelegen würde.
Ein immer häufigeres Problem ist die exzessive private Internetnutzung während der Arbeitszeit. Ist diese vom Arbeitgeber verboten und surft ein Mitarbeiter dennoch stundenlang privat, kann dies nach einer Abmahnung zur Kündigung führen.
Die Anhörung des Betriebsrats ist nach § 102 Betriebsverfassungsgesetz vor jeder Kündigung zwingend erforderlich. Ein Formfehler bei der Anhörung, etwa eine unvollständige Information des Gremiums, macht die gesamte Kündigung unwirksam.
Von der Pflichtverletzung zur Kündigung: Ein typischer Ablauf
Der Weg zu einer rechtssicheren verhaltensbedingten Kündigung folgt einem klaren Muster. Für Arbeitnehmer ist es wichtig, diese Schritte zu kennen, um beurteilen zu können, ob der Arbeitgeber alles korrekt gemacht hat.
| Schritt | Beschreibung |
|---|---|
| 1. Pflichtverletzung | Der Arbeitnehmer begeht ein steuerbares, vertragswidriges Fehlverhalten. |
| 2. Abmahnung | Der Arbeitgeber erteilt eine formell korrekte Abmahnung (außer bei schweren Verstößen). |
| 3. Erneute Pflichtverletzung | Der Arbeitnehmer wiederholt ein gleichartiges Fehlverhalten trotz der vorherigen Abmahnung. |
| 4. Negative Prognose | Der Arbeitgeber stellt fest, dass keine Besserung zu erwarten ist. |
| 5. Betriebsratsanhörung | Der Betriebsrat (falls vorhanden) wird ordnungsgemäß zur geplanten Kündigung angehört. |
| 6. Interessenabwägung | Der Arbeitgeber wägt sein Kündigungsinteresse gegen das Schutzinteresse des Arbeitnehmers ab. |
| 7. Kündigungsausspruch | Die Kündigung wird schriftlich formuliert und dem Arbeitnehmer zugestellt. |
Fazit: Wissen ist Ihr bester Schutz
Eine verhaltensbedingte Kündigung ist kein Schnellschuss, sondern das Ergebnis eines Prozesses mit hohen rechtlichen Anforderungen. Die Beispiele zeigen, dass es stets um ein vorwerfbares und willentliches Fehlverhalten gehen muss, das in der Regel zuvor abgemahnt wurde. Die zentrale Botschaft ist, dass nicht jeder Fehler und nicht jede Unstimmigkeit sofort eine Kündigung rechtfertigt. Das Wissen um die Voraussetzungen, die Bedeutung der Abmahnung und die Notwendigkeit einer fairen Interessenabwägung gibt Ihnen die nötige Sicherheit, Ihre Situation richtig einzuschätzen und Ihre Rechte zu wahren.
Häufig gestellte Fragen
Kann ich wegen einer einzigen Verspätung gekündigt werden?
Nein, eine einmalige Verspätung rechtfertigt in aller Regel keine Kündigung. Dafür sind wiederholte und abgemahnte Verstöße gegen die Pünktlichkeitspflicht erforderlich.
Was ist der Unterschied zwischen einer ordentlichen und einer fristlosen verhaltensbedingten Kündigung?
Eine ordentliche Kündigung beendet das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der gesetzlichen oder vertraglichen Kündigungsfrist. Eine fristlose (außerordentliche) Kündigung beendet es sofort und ist nur bei extrem schweren Verfehlungen möglich, die eine Fortsetzung unzumutbar machen (z.B. Diebstahl).
Muss ich eine Kündigungsschutzklage einreichen?
Wenn Sie die Kündigung für unwirksam halten und Ihren Arbeitsplatz behalten oder eine Abfindung aushandeln möchten, müssen Sie aktiv werden. Sie haben nach Erhalt der Kündigung nur drei Wochen Zeit, um eine Kündigungsschutzklage beim Arbeitsgericht einzureichen.
Zählt eine Krankheit als verhaltensbedingter Kündigungsgrund?
Nein, eine Krankheit ist kein steuerbares Verhalten. Häufige Kurzerkrankungen oder eine Langzeiterkrankung können aber unter Umständen eine personenbedingte Kündigung begründen. Ein verhaltensbedingter Grund kann jedoch vorliegen, wenn Sie Ihre Arbeitsunfähigkeit nicht oder zu spät melden (Verstoß gegen die Anzeigepflicht).