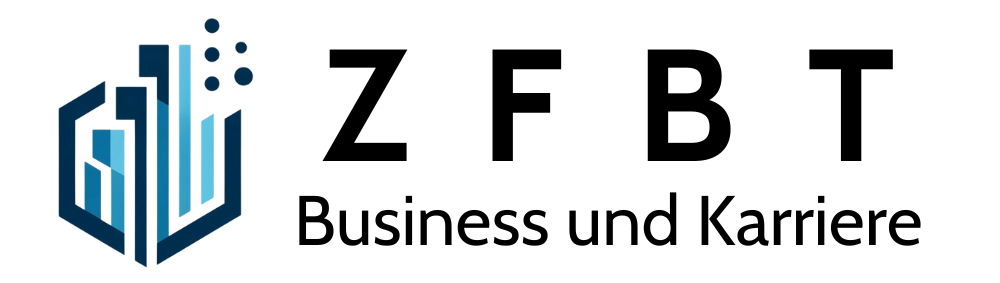Der Brief liegt auf dem Tisch, das Gespräch ist beendet. Eine Kündigung in der Probezeit ist ein harter Einschnitt und wirft unzählige Fragen auf. Mitten in der emotionalen Achterbahnfahrt und der Sorge um die Zukunft taucht eine ganz pragmatische, aber dringende Frage auf, die Klarheit erfordert: Muss ich nach der Kündigung in der Probezeit eigentlich noch zur Arbeit erscheinen? Diese Frage ist mehr als nur eine Formalität; sie entscheidet über Ihre nächsten Schritte, Ihre Rechte und Pflichten.
Dieser Artikel ist Ihr verlässlicher Begleiter auf dem Weg durch diese unsichere Phase. Wir führen Sie Schritt für Schritt von der ersten Verwirrung hin zu einem klaren Verständnis Ihrer Situation, damit Sie am Ende genau wissen, was zu tun ist und selbstbewusst handeln können.
- Grundsätzliche Arbeitspflicht: Ja, auch nach einer Kündigung in der Probezeit müssen Sie grundsätzlich bis zum Ende der Kündigungsfrist weiterarbeiten.
- Gesetzliche Kündigungsfrist: Die gesetzliche Frist beträgt laut § 622 Abs. 3 BGB exakt zwei Wochen, sofern vertraglich nichts anderes (längeres) vereinbart wurde.
- Ausnahmen existieren: Die Arbeitspflicht kann durch eine fristlose Kündigung, eine Freistellung durch den Arbeitgeber oder einen Aufhebungsvertrag entfallen.
- Kein Kündigungsgrund nötig: In der Probezeit benötigt der Arbeitgeber keinen Grund für eine ordentliche Kündigung, da der allgemeine Kündigungsschutz noch nicht greift.
- Anspruch auf Gehalt und Urlaub: Sie haben bis zum letzten Tag des Arbeitsverhältnisses Anspruch auf Ihr volles Gehalt und den anteiligen Resturlaub.
Der Paukenschlag: Die Kündigung ist da – und jetzt?
Dieser Moment fühlt sich oft an wie ein Fall ins Leere. Gestern noch waren Sie Teil des Teams, heute halten Sie ein Dokument in den Händen, das alles verändert. Die erste und wichtigste Regel lautet: Ruhe bewahren. Ihre rechtliche Position ist klarer definiert, als Sie vielleicht denken.
Die direkte Antwort auf die Kernfrage lautet: Ja, das Arbeitsverhältnis besteht fort.
Eine ordentliche Kündigung, sei es von Ihnen oder vom Arbeitgeber ausgesprochen, beendet den Arbeitsvertrag nicht sofort. Sie leitet lediglich das Ende ein. Zwischen dem Tag der Kündigung und dem tatsächlichen Vertragsende liegt die sogenannte Kündigungsfrist. Und während dieser Zeit bleiben die Hauptpflichten aus dem Arbeitsvertrag für beide Seiten bestehen.
Für Sie bedeutet das: die Pflicht zur Erbringung Ihrer Arbeitsleistung. Für Ihren Arbeitgeber bedeutet das: die Pflicht zur Zahlung Ihres Gehalts.
Die rechtliche Grundlage: Ein Blick ins Gesetzbuch
Die Probezeit ist kein rechtsfreier Raum. Ihre Bedingungen sind im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) klar geregelt. Die für Sie entscheidende Vorschrift ist § 622 Abs. 3 BGB. Dort steht, dass das Arbeitsverhältnis während einer vereinbarten Probezeit, längstens für die Dauer von sechs Monaten, mit einer gesetzlichen Kündigungsfrist von zwei Wochen gekündigt werden kann.
Was bedeutet das konkret?
Die Frist von zwei Wochen ist der gesetzliche Standard. Sie kann an jedem beliebigen Tag beginnen – nämlich an dem Tag, an dem die Kündigung zugeht. Ab dann laufen 14 Kalendertage, an deren Ende das Arbeitsverhältnis endet. Bis zu diesem Zeitpunkt sind Sie verpflichtet, Ihre vertraglich vereinbarte Arbeit zu leisten.
Die Probezeit muss explizit im Arbeitsvertrag vereinbart sein. Ohne eine solche Klausel gibt es keine verkürzte Kündigungsfrist, und es gelten von Anfang an die längeren, gesetzlichen oder tariflichen Kündigungsfristen.
Die folgende Tabelle verdeutlicht die zentralen Unterschiede zwischen der Phase innerhalb und außerhalb der Probezeit.
| Aspekt | Während der Probezeit (max. 6 Monate) | Nach der Probezeit |
|---|---|---|
| Kündigungsfrist | 2 Wochen (gesetzlicher Standard) | Mindestens 4 Wochen zum 15. oder Ende des Monats (verlängert sich mit Betriebszugehörigkeit) |
| Kündigungsgrund erforderlich? | Nein (außer bei Diskriminierung) | Ja (betriebs-, personen- oder verhaltensbedingt laut Kündigungsschutzgesetz) |
| Anwendbares Gesetz | § 622 Abs. 3 BGB | Kündigungsschutzgesetz (KSchG) und § 622 Abs. 1 & 2 BGB |
Wenn die Arbeitspflicht entfällt: Die drei großen Ausnahmen
Keine Regel ohne Ausnahme. Auch wenn die Weiterarbeit der Normalfall ist, gibt es drei wichtige Szenarien, in denen Sie nach einer Kündigung nicht mehr im Büro oder an der Werkbank erscheinen müssen. Es ist entscheidend, diese zu kennen, um Ihre Situation korrekt einschätzen zu können.
Haben Sie es mit einer dieser Situationen zu tun?
1. Die fristlose Kündigung: Der sofortige Schlussstrich
Die fristlose, auch außerordentliche Kündigung genannt, ist das schärfste Schwert des Arbeitsrechts. Sie beendet das Arbeitsverhältnis mit sofortiger Wirkung. Die Kündigungsfrist entfällt komplett, und damit auch Ihre Pflicht, weiterhin zur Arbeit zu kommen.
Allerdings kann eine fristlose Kündigung nicht einfach so ausgesprochen werden. Der Arbeitgeber benötigt dafür einen wichtigen Grund nach § 626 BGB. Das bedeutet, es muss ein so schwerwiegendes Fehlverhalten vorliegen, dass dem Arbeitgeber die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses selbst für die kurze Dauer der Probezeit-Kündigungsfrist unzumutbar ist.
Typische Gründe für eine fristlose Kündigung sind:
- Diebstahl oder Unterschlagung von Firmeneigentum
- Arbeitszeitbetrug in erheblichem Umfang
- Grobe Beleidigungen oder Tätlichkeiten gegenüber Kollegen oder Vorgesetzten
- Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz
- Verrat von Geschäftsgeheimnissen
Eine fristlose Kündigung ist ein schwerer Vorwurf. Sollten Sie eine erhalten, ist eine rechtliche Beratung fast immer ratsam.
2. Die Freistellung: Bezahlter Urlaub wider Willen
Die zweite Ausnahme ist die Freistellung durch den Arbeitgeber. Hierbei teilt Ihnen der Arbeitgeber mit, dass er auf Ihre Arbeitsleistung für den Rest der Kündigungsfrist verzichtet. Sie müssen also nicht mehr zur Arbeit kommen, erhalten aber bis zum Vertragsende Ihr volles Gehalt.
Warum sollte ein Unternehmen das tun? Oft geschieht dies, um Spannungen im Team zu vermeiden, wenn die Kündigung für Unruhe gesorgt hat. Manchmal will der Arbeitgeber auch verhindern, dass ein gekündigter Mitarbeiter noch Zugriff auf sensible Daten oder Kundenkontakte hat. Eine Freistellung kann einseitig vom Arbeitgeber angeordnet werden, wenn er ein berechtigtes Interesse daran hat.
3. Der Aufhebungsvertrag: Der gemeinsame Weg
Die dritte Möglichkeit ist ein Aufhebungsvertrag. Dies ist keine Kündigung im klassischen Sinne, sondern eine einvernehmliche Vereinbarung zwischen Ihnen und dem Arbeitgeber, das Arbeitsverhältnis zu einem bestimmten Zeitpunkt zu beenden. Dieser Zeitpunkt kann sofort sein oder ein anderes, frei verhandeltes Datum.
Ein Aufhebungsvertrag bietet Flexibilität, birgt aber auch Risiken. Der größte Vorteil ist, dass Sie die Bedingungen Ihres Ausscheidens mitgestalten können. Der größte Nachteil ist die Gefahr einer Sperrzeit beim Arbeitslosengeld durch die Agentur für Arbeit, da Sie aktiv an der Beendigung Ihres Beschäftigungsverhältnisses mitgewirkt haben.
Auch bei einer Kündigung in der Probezeit muss der Betriebsrat, sofern vorhanden, gemäß § 102 BetrVG angehört werden. Eine ohne Anhörung des Betriebsrats ausgesprochene Kündigung ist unwirksam.
Sonderfälle und Schutzrechte: Wenn andere Regeln gelten
Die Probezeit hebt nicht alle Schutzmechanismen für Arbeitnehmer auf. Bestimmte Personengruppen genießen auch in den ersten sechs Monaten einen besonderen Status, der eine Kündigung erschwert oder sogar unmöglich macht.
Gehören Sie zu einer dieser Gruppen?
Der stärkste Schutz besteht für Schwangere. Sobald der Arbeitgeber von der Schwangerschaft weiß, ist eine Kündigung nach § 17 Mutterschutzgesetz (MuSchG) so gut wie ausgeschlossen. Dieser Schutz gilt ab dem ersten Tag des Arbeitsverhältnisses und besteht bis vier Monate nach der Entbindung.
Auch für Auszubildende gelten nach Ablauf ihrer (maximal viermonatigen) Probezeit extrem strenge Regeln. Sie können dann nur noch aus einem wichtigen Grund fristlos gekündigt werden (§ 22 BBiG).
Ein häufiges Missverständnis betrifft schwerbehinderte Menschen. Der besondere Kündigungsschutz für Schwerbehinderte greift erst nach einer Wartezeit von sechs Monaten. Innerhalb der Probezeit können sie also wie jeder andere Arbeitnehmer mit der verkürzten Frist gekündigt werden.
Ihre Checkliste für die letzten zwei Wochen: Rechte sichern
Wenn Sie also zur Weiterarbeit verpflichtet sind, wie gestalten Sie die verbleibende Zeit am besten und sichern Ihre Ansprüche? Es geht darum, einen professionellen und sauberen Abschluss zu finden.
Anspruch auf Gehalt: Selbstverständlich muss Ihr Lohn oder Gehalt bis zum allerletzten Tag des Arbeitsverhältnisses pünktlich und in voller Höhe gezahlt werden. Prüfen Sie Ihre letzte Abrechnung genau.
Resturlaub: Ihnen steht anteiliger Jahresurlaub zu. Für jeden vollen Monat, den Sie im Unternehmen beschäftigt waren, erwerben Sie einen Anspruch auf ein Zwölftel Ihres Jahresurlaubs. Kann dieser Urlaub in der Kündigungsfrist nicht mehr genommen werden, muss er finanziell abgegolten werden.
Arbeitszeugnis: Sie haben einen gesetzlichen Anspruch auf ein Arbeitszeugnis. Verlangen Sie ein „qualifiziertes“ Zeugnis, das nicht nur Art und Dauer Ihrer Tätigkeit beschreibt, sondern auch Ihre Leistung und Ihr Sozialverhalten bewertet.
Meldung bei der Agentur für Arbeit: Spätestens drei Tage nachdem Sie die Kündigung erhalten haben, müssen Sie sich bei der Agentur für Arbeit arbeitssuchend melden. Versäumen Sie diese Frist, droht eine Sperrzeit beim Arbeitslosengeld.
Fazit: Mit Wissen und Klarheit nach vorne blicken
Die Kündigung in der Probezeit ist ein Rückschlag, aber kein unüberwindbares Hindernis. Die anfängliche Unsicherheit weicht nun hoffentlich einer klaren Perspektive. Sie wissen jetzt, dass die Pflicht zur Weiterarbeit die Regel ist, aber auch, welche wichtigen Ausnahmen es gibt. Sie kennen die entscheidende Zwei-Wochen-Frist und verstehen, dass Ihre Rechte auf Gehalt und Urlaub bis zum Schluss bestehen bleiben. Nutzen Sie dieses Wissen, um die verbleibende Zeit professionell zu managen, Ihre Ansprüche zu sichern und die Weichen für Ihre berufliche Zukunft neu zu stellen. Jeder Abschluss ist auch ein Neuanfang.
Häufig gestellte Fragen
Kann ich während der Probezeit gekündigt werden, wenn ich krank bin?
Ja, eine Kündigung während einer Krankheit ist auch in der Probezeit zulässig. Die Kündigung beendet das Arbeitsverhältnis dann nach Ablauf der zweiwöchigen Frist. Ihr Anspruch auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall bleibt davon unberührt.
Muss mein Arbeitgeber die Kündigung in der Probezeit begründen?
Nein, für eine ordentliche Kündigung innerhalb der ersten sechs Monate muss der Arbeitgeber keinen Grund angeben. Eine Ausnahme besteht, wenn die Kündigung willkürlich oder diskriminierend ist, zum Beispiel aufgrund Ihrer Herkunft oder Ihres Geschlechts.
Was passiert, wenn ich nach der Kündigung einfach nicht mehr zur Arbeit gehe?
Das wäre eine Arbeitsverweigerung und somit eine schwere Pflichtverletzung. Der Arbeitgeber könnte Sie in diesem Fall fristlos kündigen und unter Umständen sogar Schadensersatzansprüche geltend machen, wenn ihm durch Ihr Fehlen ein nachweisbarer Schaden entsteht.
Verlängert sich die Probezeit durch Krankheitstage?
Nein, Krankheitstage verlängern die vertraglich vereinbarte Probezeit nicht. Die Sechs-Monats-Frist läuft kalendarisch ab, unabhängig von Fehlzeiten. Eine Verlängerung ist nur möglich, wenn dies von vornherein vertraglich so vorgesehen war.